ANALYSE. Das Erkenntnis zur Bundespräsidenten-Wahl mag weltfremd sein. Auch die jüngste Judikatur ist Holzinger und Co. jedoch zum Verhängnis geworden: Sie konnten nicht mehr anders – und werden das künftig noch viel weniger tun können.
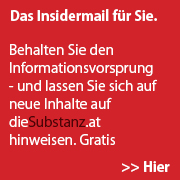 Manipulation müsse keine nachgewiesen werden, es reiche schon, wenn eine solche in einem Ausmaß möglich gewesen wäre, dass es einen anderen Sieger gegeben hätte. Diese Botschaft des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) ist erst jetzt bei der Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Sie mag weltfremd sein. Außerdem mögen die Höchstrichter um Präsident Gerhart Holzinger damit Politik zugunsten der Freiheitlichen machen, wie Kommentatoren kritisieren. Allein: Sie konnten nicht mehr anders. Beim besten Willen nicht. Und das verheißt auch für die Zukunft nichts Gutes.
Manipulation müsse keine nachgewiesen werden, es reiche schon, wenn eine solche in einem Ausmaß möglich gewesen wäre, dass es einen anderen Sieger gegeben hätte. Diese Botschaft des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) ist erst jetzt bei der Aufhebung der Bundespräsidenten-Stichwahl einer breiteren Öffentlichkeit bekannt geworden. Sie mag weltfremd sein. Außerdem mögen die Höchstrichter um Präsident Gerhart Holzinger damit Politik zugunsten der Freiheitlichen machen, wie Kommentatoren kritisieren. Allein: Sie konnten nicht mehr anders. Beim besten Willen nicht. Und das verheißt auch für die Zukunft nichts Gutes.
Allein in den vergangenen acht Monaten vor dem Erkenntnis zur Bundespräsidenten-Wahl haben die Höchstrichter ihren Kurs gleich zwei Mal verfestigt: Am 23. November, als sie Bürgermeister-Stichwahlen in Bludenz und Hohenems (Vorarlberg) kippten; und am 13. Juni, als sie dies im Falle der Bezirkswahlen in Wien-Leopoldstadt taten.
Beide Male waren die Richter kompromisslos und hielten fest: Wahlvorschriften sind auf Punkt und Beistrich einzuhalten. Wird dies in einem Ausmaß nicht getan, dass dadurch Veränderungen möglich werden, die etwa einem anderen Kandidaten zum Sieg verholfen hätten, ist die Wahl zu wiederholen.
In Bludenz und Hohenems waren Wahlkarten etwa Familienangehörigen ausgehändigt worden. Das stehe in einem Widerspruch zur Wahlordnung, „die Möglichkeit von Manipulationen und Missbräuchen im Wahlverfahren ausschließen will“, so die Verfassungsrichter in ihrem Erkenntnis dazu; und das gehe schon zu weit – „eines Nachweises einer konkreten – das Wahlergebnis tatsächlich verändernden – Manipulation“ bedürfe es jedenfalls nicht mehr.
Irgendwo werden sich immer Fälle finden lassen, in denen die Vorschriften nicht exakt eingehalten worden sind.
Nahezu wortwörtlich wiederholten das die Richter erst am 13. Juni in ihrem Erkenntnis zur Bezirksvertretungswahl im zweiten Wiener Gemeindebezirk, wo eine Differenz zwischen der Zahl der abgegebenen Stimmen und der Zahl der Wahlkarten nicht aufgeklärt werden konnte. Die Differenz betrug 23. Die Grünen hatten beim Urnengang im vergangenen Oktober 21 Stimmen mehr erreicht als die Freiheitlichen. Sehr, sehr theoretisch hätte die Reihenfolge ohne die 23 Stimmen also auch umgekehrt sein können – und das bewog die Höchstrichter bereits dazu, sich für eine Wiederholung auszusprechen.
Gut zwei Wochen später blieb ihnen folglich keine andere Wahl mehr, als dieser Linie auch bei der Bundespräsidenten-Wahl treu zu bleiben: „Die gesetzlichen Regelungen für eine Wahl müssen strikt ausgelegt werden“, hatten sie am 13. Juni in ihrer Presseerklärung noch dazu wissen lassen – und sich damit jeglichen Spielraums beraubt.
Das freilich könnte Österreich in Zukunft zum Problem werden: Wenn irgendwo eine Wahl knapp ausgeht, kann der Verlierer zuversichtlich zu einer Anfechtung schreiten. Es werden sich immer Fälle finden lassen, in denen die Vorschriften nicht exakt eingehalten worden sind. Einmal wird eine Auszählung etwas zu früh begonnen, einmal fehlen dazu vorgesehene Leute. Und dann wird der Verfassungsgerichtshof an seine Judikatur gebunden sein: Nachdem er bei einer hochpolitischen Bundespräsidenten-Stichwahl eine Wiederholung erzwungen hat, wird er seine Judikatur bei weniger bedeutenden Urnengängen erst recht nicht ändern können. Sonst würde er wissen lassen, dass er Norbert Hofer keine zweite Chance hätte geben müssen.
